Na sowas: Junge Frau aus L.A., Journalistin, schwul, schreibt einen Queer Noir, führt darin, ganz nebenbei, das geifernde MAGA-Amerika am Nasenring durch die (literarische) Manege und hat dann auch noch – huch! – marxistische Theorie studiert? Von Mar-a-Lago aus betrachtet, ist das ein klarer Fall für die Nationalgarde. Aus unserer Sicht der Pageturner dieses langsam zu Ende gehenden Sommers
DAS BUCH: „Killer Potential“ von Hannah Deitch geht steil bei Barnes&Noble und in anderen schicken Buchhandlungen in den USA. Wird gefeiert von LGBTQ-Szeneblogs, in virtuellen Bookshops wie Gay’s The Word und Bookclubs wie sapph.lit – was schön ist, weil es (auch) ein Indiz dafür ist, dass der Kulturkampf, den Trump und Co. in den Staaten gegen alle möglichen demokratischen Milieus entfesselt haben, noch nicht verloren ist. Bei uns dagegen läuft Deitch’s „literarischer Thriller“ (bedauerlicherweise) unterm Radar. Hätte es den einen Text in der taz nicht gegeben – der zu Recht darauf verweist, wie souverän hier eine Debütantin „das Basis-Setting ihrer hoch spannenden Story mit neuen, aktuellen Perspektiven auf die amerikanische Gesellschaft verbindet“ – wären wir vielleicht nie auf dieses Buch gestoßen. Aber man muss auch sagen, dass sich die dafür Zuständigen nicht sonderlich viel Mühe gegeben haben mit dem Roman (der in Deutschland von Ullstein herausgegeben wird). Im Buchladen unseres Vertrauens zum Beispiel landete „Killer Potential“ auf einem Grabbeltisch mit dem Aufsteller: „Ich weiß den Titel nicht und auch nicht den Autor. Aber das Cover war gelb“ (kein Fake, LOL!). Teaser wie „Messerscharf und jede Menge Twists- schnallen Sie sich an!“ (deutsche Ausgabe) klingen trashig, nur ist das Buch halt kein Trash.„Destined for Greatness. Wanted for Murder“ (USA) bringt das Drama um Evie Gordon, Deitch’s Heldin, im Vergleich schon sehr viel besser auf den Punkt. Am besten aber fasst der französische Titel „Ennemies Publique“ zusammen, worum’s geht. Die Franzosen halt … Hommes de lettres qua nature. Danke, dafür!
DIE AUTORIN: Bevor sie mit dem Schreiben angefangen hat, hat sie viel gelesen – und tut es immer noch, sagt Hannah Deitch.: „Dabei kommt’s mir gar nicht so sehr aufs Thema an, sondern mehr auf die Stimme einer Autor:in, ob ich die mag, ob ich klug oder witzig finde, wie er oder sie schreibt. Es kann auch mal nur die Perspektive sein, eine spezielle Sicht auf die Welt, die mir gefällt oder die ich spannend finde. Hauptsache, es ist irgendwie erhellend.“ Selbst veröffentlichte Deitch bisher in: LA Times, LA Weekly und in der LA Review of Books, kommt also vom Journalismus (inkl. Master in Journalismus der University of Southern California in L.A.). Nicht ganz unwesentlich, weil es die Zwei- und Dreifach-Codierungen von „Killer Potential“ erklärt, sind außerdem ein Studium marxistischer Theorie und zeitgenössischer Popkultur an der UC Irvine, wo sie aktuell in Englisch promoviert.
Deitch, die sich wie Evie Gordon im Roman selbst lange als Nachhilfelehrerin finanziell über Wasser gehalten hat, kennt die existenziellen Nöte ihrer Heldin aus eigener Erfahrung. Sie weiß um den Klassismus, der in der entwürdigenden Situation besteht, dass eine Tutorin, die jeden Cent braucht, Teenager aus Millionärshaushalten featuren soll, deren Eltern ihnen jeden Abschluss dieser Welt kaufen können und das im Zweifel auch tun – während man Leute wie sie für einen Hungerlohn arbeiten lässt und beim geringsten Anlass feuert. Wie sehr sie das beschäftigt, kann man daran sehen, wie oft sie in Interviews auf ihre Zeit als Tutorin zu sprechen kommt. Und, natürlich, an den quälenden Selbstbefragungen Evies im Roman: „Wieso gehörte den Comedians, mit denen ich auf beschissenen Wohnheim-Partys Benzos geworfen hatte, nur wenige Jahre nach dem College ein Haus in Westchester?“ Und wieso lebt sie, trotz College-Abschluss, in diesem versifften Apartment, zusammen mit acht bis zwölf „ganz besonderen Menschen“, die auch nicht wissen, woher sie das Geld für die Miete nehmen sollen? Evie Gordon, Tochter eines Lehrers und einer Friseuse: Hat nur den einen Job als Nachhilfelehrerin. Plus neunundneunzigtausend Dollar Schulden aus einem noch nicht zurückgezahlten Studiendarlehen. „Killer Potential“: Ist auch die Suche nach dem Fehler im System.
DIE GESCHICHTE: Wer könnte uns die besser erzählen als Hannah Deitch selbst? Bitte schön: „Killer Potential is about a former gifted student turned burnout SAT tutor named Evie Gordon who shows up for work one Sunday and discovers the wealthy parents of one of her students freshly murdered in their Los Angeles mansion. As she’s about to escape and call the police, she hears someone crying for help: a tied-up woman in the closet. After they’re spotted at the crime scene, Evie and this mysterious hostage are forced to go on the run, Thelma and Louise style. Within days, their faces are on every television, branded as 21st-century Charles Manson wannabes trying to spark a class war. There’s a murder mystery, there’s a crime thriller, there’s even an unexpected love story. Simmering beneath it all is a stark commentary on what it means to pursue the American dream and social mobility — and what happens when you realize that it’s just a fantasy.„
Es ist also, mit anderen Worten, ein Scheißtag für Evie Gordon, die wir schon kurz kennengelernt haben, einer von der Sorte, an denen eins zum andern kommt, und die, wenn’s dumm läuft, dein kleines bisschen Leben komplett ruinieren. Nein, das alles sieht nicht gut aus: Zwei Tote und deine DNA am Tatort. Dass du nicht, wie du’s eigentlich wolltest, die Cops gerufen hast. Und dann noch „die Frau“, die du nicht kennst und über die du nichts weißt, die nicht redet, weil sie entweder nicht kann oder nicht will, weil sie, wie’s aussieht, mindestens traumatisiert und im Zweifel selbst Opfer eines Verbrechens geworden ist. Dein Reflex war, dass du helfen wolltest. Aber die Konsequenz ist, dass „die Frau“ jetzt hier, mit dir, in deinem Auto sitzt – das du wahrscheinlich schnell gegen ein anderes tauschen solltest, um dir das bisschen Zeit zu verschaffen, den Abstand, den du brauchst, um dich einigermaßen zu sortieren. Aber die Zeit geben sie dir nicht: „In der Ferne hörten wir Polizeisirenen. Wo fahren wir hin, fragte ich. Wir. So schnell fiel die Entscheidung.“

WAS DIE ANDEREN SAGEN: Es fällt auf, wie sehr sich vor allem (Bestseller-)Autor:innen für Hannah Deitch begeistern: „Killer Potential läutet die Ankunft einer atemberaubenden neuen literarischen Stimme ein. Ein wildes, absolut einzigartiges Debüt“ , findet, beispielsweise, Kirstin Chen („Counterfeit“). – „Deitchs Schreibstil ist rasant und unbestreitbar mutig. Dies ist die Art von Buch, die sich in Ihr Gehirn einprägt; eine wilde Reise“, verneigt sich Kristen Arnett („Mostly Dead Things“). – Paula Hawkins, deren „Girl on the Train“ auch in Deutschland zum Publikumserfolg wurde, sagt: „Hannah Deitch hat Thelma & Louise ein zeitgemäßes Update verpasst“, Stellvertretend für die eingangs erwähnten Literaturblogs – und weil sich Deitch selbst auf Instagram ausdrücklich über diese Kritik freut – hier noch die Einschätzung von Julia Kastner von pagesofjulia.com: Ihr gefällt vor allem die Vielschichtigkeit des Buchs. Das Verbrechen in den Hollywood Hills ist für sie die Folie für ein komplexes Psychodrama: „Through Evie and Jae’s fragile, yearning, mistrustful bond, Deitch explores privilege and the divide between the haves and have-nots; sex and sexuality; trust and betrayal; what it means to be a „nice“ or „good“ person; and ambition and aimlessness.“
WAS WIR SAGEN: Nette Idee von Deitch, kurz mal das Stichwort „Thelma & Louise“ fallen zu lassen. War da nicht was? Genau: Zwei Frauen im Thunderbird, auf der Flucht vor Recht und Gesetz oder dem, was sich dafür hält. Das kommt einem schon deshalb vertraut vor, weil speziell das amerikanische Kino dieses Motiv in unzähligen Varianten immer wieder durchgespielt hat – man muss nur den Thunderbird durch zwei Pferde und Geena Davis und Susan Sarandon durch Robert Redford und Paul Newman ersetzen und landet bei „Butch Cassidy und Sundance Kid“. Das Zwei ritten zusammen-Motiv ist allerdings ein klassisch männliches, von Ausreißern wie „Bonnie und Clyde“ oder vielleicht noch „Getaway“ mal abgesehen. Neu war 1991 (!), dass „Thelma & Louise nicht nur die Männerdomäne Roadmovie, sondern auch die Männerdomäne Western übernehmen und auf staubigen Straßen, zwischen roten Felsen zu Outlaws werden: Die beiden streifen ihre Fesseln ab, geben sich nicht mehr zufrieden mit dem, was die Welt für Frauen im Angebot hat, sondern machen ihre eigenen Regeln.“ Der Film folgt einer erklärtermaßen feministischen Agenda, die implizite Hoffnung, dass Frauen in absehbarer Zeit auch in Hollywood die Regeln machen könnten, erfüllte sich aber nicht. Dazu muss man nur Harvey Weinstein googeln. Aber das nur am Rand. Denn jede Zeit, auch unsere, hat bekanntlich so ihre Fährnisse …

Fast vier Jahre, sagt Hannah Deitch, hat sie an „Killer Potential“ geschrieben. Das heißt: Die Bilder von der Jagd auf alle, die – einmal zum „öffentlichen Feind“ erklärt – unter Trump als vogelfrei gelten, konnte sie nicht kennen. Aber als jemand, der offen lesbisch lebt und damit im MAGA-Amerika zu einer aggressiv angefeindeten Minderheit gehört, hat sie die Dinge womöglich eher kommen sehen. Deitch zeigt uns den Hass und wer ihn schürt durch die Augen Evies. Die muss auf der Flucht – raus aus Kalifornien bis Florida und quer durchs Land bis hoch nach Kanada – im TV mit ansehen, wie die Reporter ihre Mutter bedrängen: Warum hat Evie das getan? Wo ist Evie? Warum hat Ihre Tochter die Victors ermordet? „Eine Nachrichtensprecherin kam jetzt ins Bild … Sie hatte große Locken wie ein Country-Star aus Nashville und sprach sich für die Todesstrafe aus. Insbesondere für meine Hinrichtung. Wenn man mich fassen würde. Wozu es unausweichlich kommen würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Die Uhr tickt, Evie Gordon. Wir sind mehrere Millionen, eine ganze Armee besorgter Bürger, mit Mistgabel bewaffnet. Wir werden dich finden. Du wirst dafür bezahlen …“
Man würde so eine Dramaturgie gern für overdone halten. Fakt ist: Es braucht nicht viel, um im Amerika von heute zur Unperson erklärt zu werden. Es braucht nur jemand, der ernsthaft behauptet, du würdest Katzen und Hunde essen – und wenn du dann noch Migrant bist und in Springfield, Ohio lebst, kannst du anfangen zu beten. Evie macht sich keine Illusionen: Schon auf dem College konnte sie sich nur halten, weil sie klug war – und weil die Millionärssöhnchen um sie herum „mich als schmutziges Aushängeschild wollten, weil sie auf das soziale Kapital scharf waren, dass ihnen durch meinen abgefuckten Status zuteil wurde“. Jetzt ist sie quasi Freiwild: Für ein Kopfgeld von 125.000 Dollar gemeinsam mit der „Frau“ zur Fahndung ausgeschrieben, dringend verdächtig des Mordes an dem wohlhabenden Ehepaar Peter und Dinah Victor, deren Tochter Serena zu ihren Schützlingen gehörte. Natürlich gibt es keinen Beweis. Nur, wie auch im Fall der Migranten, eine Projektion, ein Bild, mit dem man arbeiten kann und von dem man weiß, dass es funktioniert, weil man damit an irgendwelche diffiusen, unterbewussten Ängste andocken kann – in diesem Fall an das zweier „abgedrehter, zugekokster Hippies, die eine Revolution anzetteln wollten“.
Evie zählt mit, wie oft in irgendwelchen Nachrichten jetzt das Stichwort „Charles Manson“ fällt (bitte „Tate-LaBianca-Morde“ googeln) – und wird langsam selber paranoid. Weil, klar: „Ich hatte jeden Sonntag bei den Victors im Esszimmer gesessen, jeden Sonntag hatten mich die Victors freundlich in ihr Heim gelassen. Und ich hatte die ganze Zeit über innerlich gebrodelt. Schließlich … hatte ich mir eine Komplizin mitgebracht, meine kaltblütige Gespielin, meine Sadie, meine Leslie, meine Patricia. Tod dem superreichen einen Prozent. Gerechtigkeit für die restlichen neunundneunzig. Als Warnung.“
Es ist eins von Hannah Deitch’s Kunststücken, wie sie ihren Roman in der Schwebe hält: Die Innenwelt der langsam, sich aufbauenden Beziehung zwischen den Flüchtenden – und die immer schrilleren Töne aus dem Außen, die sich wie grell zuckende Blitze über ihnen entladen. Deitch zeigt, wie fragil und aufgeladen die Atmosphäre zwischen den Frauen ist, die einander gern vertrauen würden, aber nicht wirklich wissen, wie weit sie dabei gehen können. Evies ambivalentes Verhältnis zur „Frau“ scheint auf, als sie die aktualisierte Phantomzeichnung sieht, mit der die Verfolger nach ihr suchen: „Erneut wurde ihr mit Tusche gezeichnetes Porträt gezeigt Es sah ihr einigermaßen ähnlich, auch wenn die Feinheiten fehlten. Die Undurchdringlichkeit ihrer dunklen Augen. Das scharfkantige Kinn. Ihr sanfter Mund. Die katzengleiche Gesichtsform. Die feindselige und betörende Architektur ihres Gesichts.“ Man spürt durch diese Zeilen hindurch, wie gern sie sich fallen lassen würde – und wie sehr sie sich kontrolliert. Die Antwort auf die Frage, die Evie sich und uns (unausgesprochen) stellt, wie lange sie das wohl durchhalten kann, wird nicht einfacher dadurch, dass Jae doch noch anfängt zu reden.
Während MAGA-Amerika darauf wartet, dass die Jagdgesellschaft aus FBI, Bundespolizei und jeder Menge selbst ernannter Freizeit-Cops (inkl. einiger Millionärssöhnchen, die gern ein paar „Hippies“ zur Strecke bringen würden) endlich liefert, darf sich, dank Deitch, die notorisch unterschätzte politische Theorie entfalten, wonach alles mit allem zusammenhängt. Breathtaking! Aber eben auch (s.o.) wirklich erhellend, wie hier eine Gesellschaft ins Dunkle kippt …
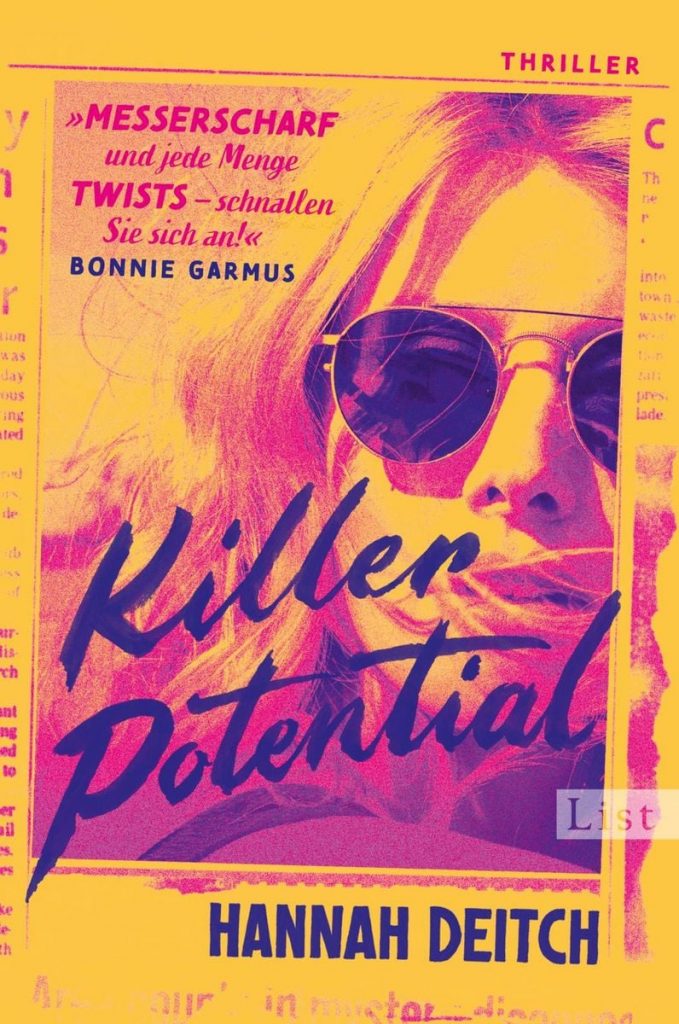

Hannah Deitch: „Killer Potential“, Ullstein Buchverlage GmbH, 397 Seiten, ca. 19,99 Euro




