„Du zerbrichst dir nicht den Kopf über das Wohlergehen aller Lebewesen. Du bist immer aus auf die Frage: Wer profitiert?“ Wer hier spricht, ist die Autorin Heike Geißler, was nach enttäuschten Erwartungen und Beziehungskrise klingt, eine Passage aus ihrem neuesten Text. „Arbeiten“ ist eine Abrechnung mit den Zumutungen unserer Arbeitswelt. Und: ROT für die, die mit dem Geld der Schwächsten die Wirtschaft pampern wollen
DAS BUCH: Kein Betthupferl für Leute, die mit dem Mantra auf den Lippen einschlafen, dass die Deutschen„wieder mehr und vor allem effektiver arbeiten müssen“ (Friedrich Merz). Oder: Dass man in Deutschland manchmal den Eindruck haben könnte, dass es den Leuten „nicht mehr um Work-Life-Balance, sondern um Life-Life-Balance“ geht (Carsten Linnemann). Andererseits ist natürlich genau das der Punkt: Dass hier eine Autorin das Thema „Arbeiten“ mehr von innen, aus der working class-Perspektive, betrachtet als Merz und Co., die irgendwann mit den Big Sowieso aus Industrie und Wirtschaft in die Glaubensgemeinschaft „Arbeit, Wachstum, Wohlstand“ eingetreten sind – und einfach nicht abschwören wollen. Im Gegenteil. Wie einen alten, muffigen Waschlappen hauen sie den Deutschen gerade ihre eigene Legende um die Ohren: Galten sie nicht eben noch als „fleißig“? Und wenn ja: Wo ist er hin, der Fleiß? Heike Geißler hätte da ein paar Antworten …
DIE AUTORIN:… schreibt „Tiraden gegen die Weltzerstörer, gegen Rechtsruck, Demokratiefeindlichkeit und Verantwortungsferne und drückt ihr Unbehagen an der gegenwärtigen Arbeitswelt aus. Sie tut das poetisch und mit leiser Ironie, gepaart mit Sensibilität und Verletzlichkeit, oft aber auch mit Wut und dem Bekennen von Ohnmacht“, findet die Jury des Klopstock-Preises für neue Literatur – der in diesem Jahr „für ihre literarische Gesamtleistung“ an, genau: Heike Geißler geht.
Die Wahl-Leipzigerin, Mutter zweier Töchter, ist 1977 in Riesa geboren und wuchs dort und in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz auf. Sie studierte Amerikanistik, Politik und Geographie in Dresden, Hispanistik und Literaturwissenschaften in Halle und arbeitete u.a. als Übersetzerin. Als Autorin machte Geißler zum ersten Mal 2002 mit ihrem Roman „Rosa“ von sich reden, für den sie den Alfred Döblin-Förderpreis bekam. 2008 wurde sie zum Ingeborg Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen und las dort aus ihrer Erzählung „Das luftige Leben“. „Saisonarbeit“, erschienen 2014, ist dann schon keine Belletristik mehr: Geißler verarbeitet darin ihre Erfahrungen mit Akkordarbeit am Band in einem Amazon-Warenlager. Eine stringente Handlung samt darin eingebundener Figuren wird man von da an selten in ihren Büchern finden. Stattdessen Bewusstseinsströme wie im Leipzig-Roman „Die Woche“ von 2022, in dem „zwei proletarische Prinzessinnen“ zwischen Gentrifizierung und Rechtsterror von der Revolte träumen (was ihr eine Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse einbrachte). In „Arbeiten“ zieht die Autorin nun allein in den Kampf – und stellt aus gegebenem Anlass die alten Fragen neu: „Nach Überleben und Wachstum. Nach Kosten und Nutzen einer Person, Nach Geben und Nehmen, Gewinnern und Verlierern in der Arbeitswelt von heute“ (Klappentext).
DIE GESCHICHTE: Heike Geißler hat nichts gegen Arbeit: „Arbeit ist auf jeden Fall das, was wir praktizieren, um hoffentlich (aber ja leider nicht immer erfolgreich) genug Geld für die Bestreitung der Lebenshaltungskosten und die Vorsorge für später zu verdienen. Manchmal ist Arbeit auch diese erfüllende Angelegenheit, die man gern verrichtet, die viel mehr zurückspielen kann als nur Geld: gute Ideen, neue Bekannte, Orte, Ansatzpunkte“, erklärt sie in einem Q&A, online bei Hanser, wo auch ihr Buch erschienen ist. Wobei, naja.
Eine notwendige Eigenschaft von Arbeit sollte schon sein, sagt sie, „dass sie in vielerlei Hinsicht Sinn stiftend ist. Sie sollte für die arbeitende Person und für die Gesellschaft Sinn ergeben, sollte konstruktiv sein und immer die sie ausübenden Menschen ernst nehmen: als lernfähige, neugierige, einfallsreiche Wesen. Sie sollte keinerlei Ressourcen ausbeuten und sich nicht als alternativlos verstehen.“ Ob Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) das meinte, als er gesagt hat: „Wir sind zum Arbeiten geboren“?
Wahr ist erst mal nur, dass der Tag der meisten Menschen mit Arbeit beginnt und damit endet. So haben wir das gelernt: „Wer gar nicht arbeitet, ist verdächtig, manchmal auch mir“, sagt Heike Geißler – und ärgert sich gleichzeitig darüber. Denn natürlich hat sie das Spiel mit den Konditionierungen – Ohne Fleiß kein Preis, Langes Fädchen, faules Mädchen, Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr – längst durchschaut. Bei ihr kommt wegen ihrer DDR-Sozialisation noch ein weiterer Aspekt dazu:„Als sogenanntes Arbeiterkind und ehemalige Jung- und Thälmannpionierin lernte ich früh, dass alle, die der Arbeit vorzugsweise fernblieben, zu verachten oder wenigstens kritisch zu beäugen waren. Zu kritisieren war in jedem Fall, dass sie eine Art Betrug an allen, die redlich arbeiteten, begehen, an allen, die die Arbeit der Arbeitsvermeider:innen an deren Stelle zu erledigen hatten.“
Es gibt da also in diesem Konzept Arbeit, wie wir es verinnerlicht haben, ein subtiles Zwangsmoment. Subtil deshalb, weil eine „freie“ Gesellschaft wie die unsere natürlich niemanden zum Arbeiten zwingt – auf einer pseudo-moralischen Ebene, mit ein paar simplen psychologischen Tricks, aber eben doch. Man ahnt, dass es für das Zusammenleben in so einer Gesellschaft ganz wesentlich darauf ankommt, wie die Politik mit dem Komplex Arbeit oder Arbeit und Soziales umgeht: Laut Geißler desaströs. Da sind, sagt sie, „so viele Zumutungen, so viel Druck und so schlechte Bedingungen“.
Ein Tiefpunkt ist für sie die aktuelle Bürgergeld-Debatte. Das Thema hat es zwar nicht mehr ins Buch geschafft. In einem Interview mit der Berliner Zeitung kurz nach dem Erscheinen von „Arbeiten“ im April hat die Autorin aber schnell reagiert – und klar gemacht, was sie davon hält. Erstens: „Die Politik tut so als gebe es nur sogenannte Sozialschmarotzer. Diese Wenigen sind aber nicht das Problem.“ Zweitens: „Jene Superreichen, die oftmals kaum Steuern zahlen, sind gerade keine Leistungsträger, auch wenn das so gern behauptet wird.“ Drittens: „Diese politische Sicht immer nur auf Leute, die sich nicht wehren können, finde ich kriminell.“
Die neuen Ausführungsbestimmungen zum Bürgergeld (jetzt: „Grundsicherung“), wonach Erwerbslose nach mehrmaligem Versäumen von Terminen im Jobcenter bis in die Obdachlosigkeit sanktioniert werden können, sind die bislang schlimmste Ausprägung eines Systems von „Vorsorge und Angstverwaltung“, wie Heike Geißler es nennt. Du kannst dir schon einen „zuverlässigen Staat“ wünschen, „der aus Anstand, Verpflichtungsgefühl und Gesetzestreue zum Wohle aller agiert“. Tatsächlich ist es so dass dieser Staat „alle, die aufgrund von Krankheit, Krisen, Lebenslust, Saumseligkeit, Unkenntnis, Pflege, Betreuung, Scheidungen keinen geradlinigen Lebenslauf haben, früher oder später im Rentenbescheid bestraft.“
Ihr Schreiben ist die Absage an dieses System.
Und „Arbeiten“ erklärt, warum der Schnitt unausweichlich war.
In Briefen an die „Liebe Arbeitswelt“ lässt Geißler uns hier teilhaben an einem Prozess der Entfremdung:„Liebe Arbeitswelt, Du weißt Bescheid: Ich war ganz auf deiner Seite. ich wollte etwas Stabiles sein, etwas für Dich Zuverlässiges, Pünktliches, etwas Rabiates, etwas pragmatisch und effizient Anpackendes, etwas, das ganz auf eine Fertigstellung eingerichtet war. Ich wollte Tempo sein und Zielstrebigkeit, ein Abbild deiner Ansprüche … Ich hatte eine sehr monothematische Landschaft in mir entstehen lassen, indem ich Dir, dieser Raumforderung namens Arbeit, nichts entgegenzusetzen vermochte oder wagte. Gar nichts. Nicht einmal Todesfälle, Geburten, Einwände, Krankheiten, Sorgen, Erdbeben, Kriege, Spiele, Unfälle, Verspätungen, Unhöflichkeiten, Missverständnisse, Erinnerungen, Erfahrungen, Unlust.“ Aber:„Was ich mit Erstaunen feststellte ist, dass es Dir nie darum ging …mein und das Leben aller, die ich kenne und mir vorstellen kann, zu verbessern. Du zerbrichst dir nicht den Kopf über das Wohlergehen aller Lebewesen. Du bist immer aus auf die Frage: Wer profitiert? Ungeachtet Deiner Lust, Dich als sterbend, als schwächelnd darzustellen, ungeachtet Deiner Ambitionen, Dich vorzugsweise als horizontal hierarchisch zu beschreiben, Dich in neue Narrative zu kleiden, Dich caring und zukunftsweisend zu geben.“
Geißler hat ihr Buch für sich und für uns geschrieben, damit wir die Deutungshoheit oder Komptenz-Kompetenz in Sachen Arbeit wiedererlangen und uns zurückholen, was man uns genommen hat. Zum Beispiel: Zeit.
„Wie fern der Traum ist, der nicht ausformulierte Möglichkeitsraum, wie fern die kontemplativen Zustände sind“, schreibt sie. Dabei seien es doch grade die unverplanten Zeiten,„die es braucht, um Zeit zu haben und Ideen anzulocken für unsere ideenarme Zeit, die alles auf den Mehrwert abklopft und jede empathische Regung in ein Geschäft zu wandeln versucht.“ Das sieht auch Simon Nagy so, einer der Autor:innen, die Geißler in ihrem Buch zitiert. Aber: „Die Einhegung von Zeit war und ist eines der zentralen Projekte des Neoliberalismus. Und unter Einhegung verstehe ich dabei den Prozess, etwas vormals gemeinsam Verwaltetes, Öffentliches in Privatbesitz zu transportieren und damit dem allgemeinen Zugriff zu entziehen“,
Es sieht also nicht gut aus für uns. Und es fallen auch immer wieder traurige Schatten über dieses Buch, etwa wenn Geißler von ihrer Mutter erzählt: „Mein Mutter, die fast immer gern gearbeitet hat, die erst in den Nachwendejahren begann, den Spaß an ihrer Arbeit zu verlieren, spätestens dann nämlich, als sie längst in München arbeitete, nicht mehr Postamtsleiterin in Chemnitz war und schließlich im Call-Center der Postbank landete. Und wie gern sie half, wie gern sie jedem Anrufer, jeder Anruferin eine Hilfe gewesen wäre, aber wie sie allen etwas verkaufen sollte, immer etwas anbieten, wonach niemand gefragt hatte, und dabei die eigentlichen Probleme nicht lösen durfte, sondern delegieren oder ignorieren musste. Das war für sie das Anstrengendste, das war der Widerspruch zwischen Wollen und Müssen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, der ihr die Arbeit zunehmend zur Qual machte.“
Auf die Frage, welche Arbeit sie am liebsten verrichtet, sagt Heike Geißler heute: „Meine Arbeit“:
„Meine Arbeit ist es, da zu sein. Meine Arbeit ist es, zu akzeptieren, dass es Gegner:innen solidarischer, zukunftsfähiger, menschenfreundlicher Lebensweisen gibt – und zugleich nie den Glauben an die Möglichkeit und Richtigkeit dieser Lebensweisen aufzugeben, sie aufzuspüren, an sie anzuknüpfen, an ihre Richtigkeit zu glauben. Die Hauptarbeit, die ich verrichte, ist es, mich aus den Angstgebinden der Welt zu wickeln, zu locken, zu schneiden. Und die Hauptarbeit ist es, mutig zu sein, es zu werden oder zu bleiben.“ Manchmal, sagt sie, denkt sie sich einfach Berufe aus und schreibt dann Texte darüber, Protokolle erfundener Menschen, die erfundene Berufe ausüben – wie den des Zauberers, der daran arbeitet,„die Fließrichtung des Geldes zu ändern“.
Ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit sei übrigens gewesen, herauszufinden, dass sie weder resilient ist noch es werden möchte: „Ich will gar nicht aushalten können … was in Details oder in Gänze nicht aushaltbar ist, will hingegen alles Unaushaltbare, Störende, Unterbrechende, Demagogische, Betrügerische abwehren, umlenken, zu seinem Ursprungsort zurückspielen. Zur Übertragung, zur Überarbeitung, zur Dekonstruktion.“
All diesen – gewaltigen – Anstrengungen verdanken wir dieses Buch.
WAS DIE ANDEREN SAGEN: „Heike Geißler denkt sich durch die Traurigkeiten, Absurditäten und Zumutungen des Arbeitslebens“ (Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur) – „Der Arbeit entkommt man nicht. Was zunächst übertrieben klingen mag, entfaltet in diesem Buch schnell eine beklemmende Plausibilität“ (Leander Berger, SWR) – „Heike Geißlers Buch ist ein willkommener Anlass, sich nach Möglichkeiten des Widerstands gegen das derzeitige Arbeitsregime umzusehen“ (Yi Ling Pan, taz)
WAS WIR SAGEN; Empathisch, solidarisch, kämpferisch! Keine Ahnung, warum wir bisher noch nichts von Heike Geißler gelesen haben. Vielleicht weil wir zu blind, zu stur, zu selbstbezogen vor uns hin geochst haben?
WAS KOMMT: Die Verleihung des Bayerischen Buchpreises 2025 am 28. Oktober in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz. Andreas Platthaus (FAZ), Cornelius Pollmer (ZEIT) und Marie Schoeß (BR) küren live die besten Bücher des Jahres in den Kategorien Belletristik und Sachbuch. Mit auf der Shortlist fürs beste Sachbuch: Heike Geißler mit ihrem Essay „Verzweiflungen“, der im Februar, kurz vor der Veröffentlichung von „Arbeiten“, bei suhrkamp erschien. Geißler analysiert darin die Verzweiflung als gesellschaftliches Phänomen und versteht ihr Buch als „literarische Intervention gegen Rechtsextremismus und andere feindliche Strömungen“.
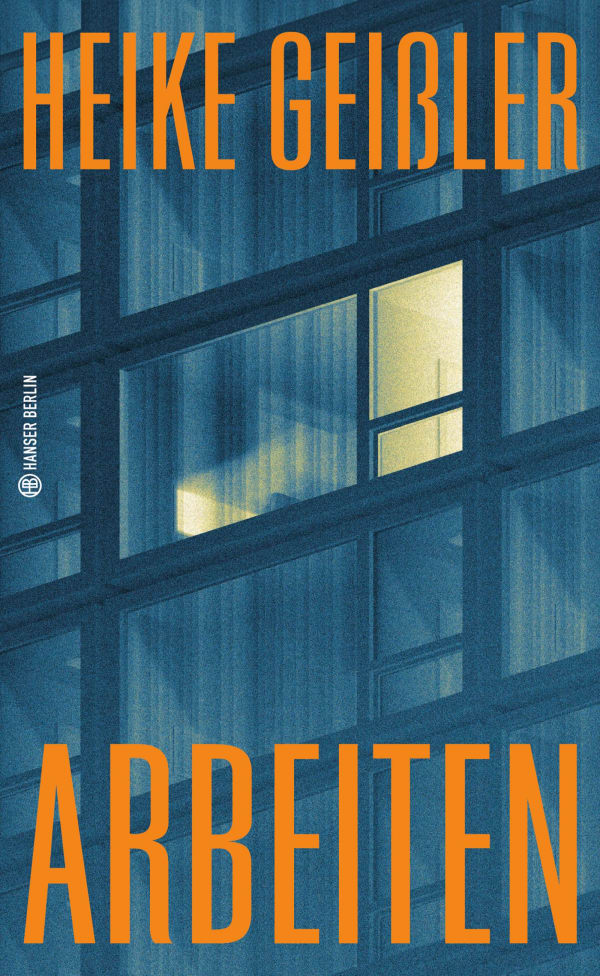

Heike Geißler: „Arbeiten“, Hanser Berlin, 125 Seiten, ca 20,60 Euro




