Man spricht nicht gern über soziale Ungleichheit in Deutschland – und schon gar nicht nimmt man dabei das K-Wort in den Mund, sagt der Soziologe und neue Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung (IfS), Stephan Lessenich. Was herauskommt. wenn Politik sich „dumm stellt“, kann man in der Pandemie sehen, so Lessenich: Arme erkrankten häufiger, prekär Beschäftigte verloren als Erste ihre (Mini-)Jobs, Schulkinder und Student*innen aus weniger privilegierten Familien wurden abgehängt. Und die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ein Interview
0941mag: Die FAZ hat Sie kürzlich einen „linken“ Soziologen genannt. Würden Sie das so unterschreiben?
Stephan Lessenich: Also, „links“ wäre jetzt nicht die erste Qualifizierung, die mir für einen Soziologen einfallen würde. Aber ich bin ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Bürger und politischer Mensch, der sich offen als „links“ zu erkennen gibt. Deshalb kann ich damit gut leben.
Was ist denn so „links“ an Ihnen?
Ich glaube, „links“ ist, einen Blick zu haben für die ungleichen Möglichkeiten von Menschen, ihr Leben zu gestalten, und den hatte ich schon immer. Deshalb habe ich auch zunächst Politikwissenschaft studiert – ich wollte verstehen, wie Politik funktioniert, um die Verhältnisse zu ändern. Ich hab’ dann aber schnell begriffen, dass man erst wissen sollte, wo die ungleichen Lebenschancen eigentlich herkommen, wie sie entstehen, wie sie immer weiter wieder verstetigt werden, warum sie so schwer zu verändern sind. Von daher passte ein Soziologiestudium mit der Ungleichheitsforschung als zentralem Thema perfekt zu meinen lebensweltlichen Anliegen: Soziale Ungleichheit zu benennen, sie zum politischen Gegenstand zu machen und für mehr Gleichheit zu streiten. Was alles eine „linke“ Agenda ist.
Wie lange wird zu sozialer Ungleichheit schon geforscht?
Eigentlich ist soziale Ungleichheit ein zentrales Thema der Soziologie von Anfang an. Sie entsteht in ihrer modernen Form im späten 19. Jahrhundert in Europa, im Zeitalter der Industrialisierung, der Wohnungsnot, der schlechten Arbeitsbedingungen und hohen Sterblichkeitsraten der Lohnarbeitenden, auch des Klassenkonflikts zwischen Lohnarbeit und Kapital – also mitten in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation, wo soziale Ungleichheit prominent und präsent wird. Das hat die Soziologie geprägt und prägt sie bis heute.
Kann man sagen: Soziale Ungleichheit entsteht mit ziemlicher Sicherheit immer da, wo Menschen sich miteinander arrangieren müssen, zu jeder Zeit und quer durch die politischen Systeme?
Soziale Ungleichheit ist ein Strukturmerkmal von menschlicher Vergesellschaftung, des Zusammenlebens unter Menschen. Soziologisch interessant ist, wie sich zu unterschiedlichen Zeiten, bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen, in unterschiedlichen Ländern und eben auch in unterschiedlichen politischen Systemen soziale Ungleichheiten gestalten. In Europa und in Deutschland zum Beispiel ist offensichtlich, dass die Ungleichheitsmuster, mit denen wir leben und uns arrangieren müssen, durch die Organisation des Wirtschaftslebens geprägt sind. Durch das, was ich Kapitalismus nennen würde.
Auch ein moderner, sozialer Rechtsstaat wie der unsere produziert soziale Ungleichheit?
Durch den Sozialstaat, durch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind viele Ungleichheiten abgemildert oder reduziert worden. Teilweise sind Ungleichheiten auch abgeschafft worden – etwa dadurch, dass man in der Demokratie wählen darf, dass nicht mehr nur Männer, sondern auch Frauen wählen dürfen, dass das Wahlrecht nicht vom Einkommen, vom Vermögen oder vom Besitz abhängig ist. Es reicht, Bürger*in eines Staatswesens zu sein. Trotzdem gibt es auch 2021 massive Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, die auch jeden Tag wieder neu hergestellt werden. Und es gibt Bereiche, wo Ungleichheiten zu- und nicht abnehmen. Die Corona-Pandemie etwa wird mittlerweile zum Glück auch genau unter diesem Aspekt diskutiert.
Stimmt es, dass Corona arme Menschen härter trifft als Reiche?
Das ist so! Allerdings hat man sich in Deutschland in dieser Hinsicht ein Jahr lang dumm gestellt. Wenn besondere Betroffenheiten der Pandemie öffentlich diskutiert wurden, ging es da in erster Linie um Altersgruppen: Die Alten, die Hoch- oder Höchstaltrigen zumal, die in Pflegeheimen leben, das seien die besonders Gefährdeten und um die müsse man sich besonders kümmern. Man hat das dann noch erweitert um Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Die im engeren Sinn soziale Dimension, also die sozio-ökonomische Lebenslage der Menschen, wurde bis vor kurzem gar nicht thematisiert. Übrigens gab es lange Zeit auch keine Daten dazu. Krankenkassen haben zum Teil Daten erhoben, einzelne Städte wie Bremen haben es früh gemacht, mittlerweile macht man es auch in Köln und München. Dabei war immer klar: Ärmere Haushalte, ärmere Menschen mit weniger Ressourcen, mit kleineren Wohnungen, mit niedrigeren Bildungsabschlüssen, mit weniger Einkommen und weniger Vermögen, mit kleineren sozialen Netzwerken sind diejenigen, die von der Pandemie mit Abstand am meisten getroffen werden.
Inwiefern?
Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist größer. Die Wahrscheinlichkeit von schweren Krankheitsverläufen ist deutlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ärmere Menschen mit den Folgen der Pandemie und den Finessen der Pandemiepolitik nicht so gut umgehen können, ist größer – und damit auch das Risiko, dass sie dadurch noch weitere Einbußen erleiden.
Wenn klar war, dass wir da auf eine gesellschaftliche Schieflage zusteuern: Warum haben wir dann nicht schon zu Beginn der Pandemie mobile Impfteams in die Problemviertel der Städte geschickt?
Also, man kann sicher vieles mit der Besonderheit der Situation erklären. Damit, dass die Politik und letztlich ja die ganze Gesellschaft eher unvorbereitet in diese pandemische Situation geraten ist. Aber spätestens nach einem halben Jahr der Notfallpolitik hätte man die Lage einfach systematischer prüfen müssen.
Warum ist das nicht passiert?
Weil in Deutschland soziale Ungleichheit kein Thema der öffentlichen Auseinandersetzung war und ist. In Großbritannien etwa, wo der Klassenbegriff gut eingeführt ist, wird die öffentliche Debatte exakt unter dieser Überschrift geführt: Dass es Einkommensklassen gibt oder soziale Lagen, die eine Klassenform annehmen, wo Menschen systematisch bessere oder schlechtere Lebenschancen haben. Auch in den Vereinigten Staaten ist das so. In Deutschland dagegen hat man lange gedacht: „Bei uns sind die Ungleichheitslagen ja nicht so krass. Da brauchen wir nicht über Ungleichheit oder Klassen debattieren. Wir sind halt irgendwie so eine Mittelstandsgesellschaft.“ Doch das stimmt nicht. Auch auf dem Reichtumsniveau, auf dem wir uns hier bewegen, gibt es krasse soziale Armut, es gibt Bildungsarmut, die sich verfestigt hat und über Generationen weitergetragen wird. Es gibt Menschen, die bei Geburt schon wissen könnten, dass sie bestimmte Positionen in dieser Gesellschaft nicht erreichen werden. Aber es hat eben auch Tradition in Deutschland, dass man ungern über soziale Ungleichheit spricht – und schon gar nicht nimmt man dabei die Klassenbegrifflichkeit in den Mund. Andernfalls, wenn die Debatte schon in diese Richtung sensibilisiert gewesen wäre, wäre man auch bei Corona draufgekommen, dass das ein wichtiger Faktor ist.
Was außer Impfen hätte man konkret tun können, um sozial benachteiligten Menschen zu helfen?
Auf die Schnelle die Lebensbedingungen von Menschen oder Haushalten zu verbessern, ist schwierig. Aber, klar: So, wie man hätte sagen müssen, bei der Impfreihenfolge gehören die ärmsten Haushalte in die Prioritätenstufe eins, hätte man auch sagen müssen: Von den vielen, vielen Milliarden, die mobilisiert werden, um das gesellschaftliche Leben aufrecht zu erhalten und gewisse Sicherungen einzuziehen, müssen gerade schlechter gestellte Haushalte sofort was abbekommen – und nicht nur die Reiseveranstalter oder dass man sagt, jetzt müssen wir die Schulen auf Teufel komm raus digitalisieren.
Apropos Schule! Was ist von einer Bildungspolitik zu halten, die Kinder und Jugendliche in den Distanzunterricht abschiebt, wenn doch klar ist, dass die Schwächeren aus bildungsferneren Schichten als Erste den Anschluss verlieren?
In der Pandemie leidet die Aneignung von Bildung generell. Aber das Problem hat, wie Sie sagen, auch eine soziale Komponente. Bestimmte Haushalte sind besser aufs Lernen daheim eingestellt als andere und es war schon vor der Pandemie so, dass Kinder in solchen Haushalten besser, intensiver und mit mehr Ressourcen gefördert werden. Dagegen hat ein verlorenes Jahr in einem Haushalt, der sowieso schon schlechter gestellt ist, für die weitere Berufs- oder Bildungskarriere der Kinder massive Folgen. Dazu gibt es empirische Befunde. Aber auch hier gilt: In der Bildungspolitik sind alle Augen auf die Gymnasien gerichtet und alle Augen auf die Schulformen und die Bereiche des Bildungswesens, die von den sozialen Gruppen bevölkert werden, die sich dann auch in der Politik betätigen. Und da kommen wir zum Kern: Dass Repräsentant*innen der Mittelschichten und oberen Mittelschichten Politik machen für Mittelschichten und obere Mittelschichten und deswegen auch gewählt werden von Mittelschichten und oberen Mittelschichten. So entsteht ein Kreislauf, bei dem viele soziale Positionen dauerhaft unter die Räder kommen.

Die Pandemie hat auch viele Studierende in eine schwierige Situation gebracht. Es gab keine Präsenzveranstaltungen an den Unis. Nebenjobs, auf die Studierende oft angewiesen sind, um in Städten wie München über die Runden zu kommen, brachen weg. In der Folge ist die Zahl der Studienabbrecher gestiegen. Können/ wollen wir uns das wirklich leisten?
Jeder Ökonom würde sagen: Das ist eine Fehlallokation von Mitteln! Da hat die Gesellschaft, da haben Eltern und junge Menschen in Bildungsverläufe investiert, die Leute haben Abitur gemacht, sie haben die Hochschul-Zugangsberechtigung erworben und angefangen zu studieren – und dann brechen sie ab. Ökonomisch ist das ein Desaster. Aber es ist auch sozial problematisch, weil natürlich brechen eher diejenigen ab oder ziehen einen Studienabbruch in Erwägung, die geringere Ressourcen haben, um mit der Situation fertig zu werden. Die Studierendenschaft in München beispielsweise, an der LMU, ist noch heterogen, auch wenn es oft heißt, da studiert eh nur, wer aus „gutem Elternhaus“ kommt oder aus Haushalten, die es sich leisten können, dass ihr Kind studiert. Trotzdem gibt es auch auf dem Niveau ganz klare Ungleichheiten: Manche Studierende haben eine gute digitale Infrastruktur zu Hause, andere nicht. Manche haben ein eigenes Zimmer, wenn sie jetzt wieder daheim leben müssen, andere sitzen in der Küche. Manche haben einen eigenen Laptop, andere müssen sich den noch mit ihren Geschwistern teilen. Aber das hat keinen interessiert. Wie im Kulturbetrieb die Theater etc. durfte man die Hochschulen nicht betreten. Die Frage, wann können wir die Biergärten wieder öffnen, die Friseure oder wen auch immer, war wichtiger als die Überlegung, wie man zumindest ein hybrides System von Bildung an den Hochschulen hätte ermöglichen können. Drei Semester lang herrschte Ausnahmezustand an den Universitäten – und unter den Studierenden haben sich die Ungleichheiten dadurch noch einmal verschärft.
Sie haben eben schon die Theater genannt. Überhaupt, finde ich, konnte man in der Pandemie gut sehen, welche Priorität die Kultur bei uns genießt: Künstler*innen und Kreative, die ihren Beruf wegen Corona nicht ausüben konnten, flogen aus der Künstlersozialkasse – und mussten erst ihre Altersvorsorge aufbrauchen, damit sie wenigstens Hartz IV bekommen. Wertschätzung sieht anders aus, oder?
Die Künstlersozialkasse ist ein ganz wichtiges sozialpolitisches, sozialstaatliches Instrument und es ist klar, dass diesbezüglich für die Notlage in der Pandemie auch besondere Regularien hätten geschaffen werden müssen, und zwar sofort. Nur: So, wie halt nicht zuerst auf die Arbeitslosen geschaut wird, fallen auch kleine Selbstständige oder Künstler*innen eher durchs Raster, denn die Prioritätensetzung ist eine andere. Wenn das Wirtschaftsministerium und das Arbeitsministerium sich zusammensetzen und überlegen, was machen wir jetzt, kommen auf der einen Seite die größten Unternehmen und die so genannte „produktive Wirtschaft“, also die industriellen Kerne der Wirtschaft, in den Blick, die stabilisiert werden müssen, weil da die Wertschöpfung stattfindet. Es fällt der Blick auf Kernbelegschaften, also auf Arbeitnehmer*innen, die Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Mittlerweile haben zwar auch Politiker mit Entscheidungsbefugnis und -gewalt erkannt, dass es das Problem Künstlersozialkasse gibt. Aber dass man das so spät merkt, ist skandalös.
Man kann so eine Politik grob fahrlässig nennen. Aber sie ist auch nicht besonders empathisch und solidarisch, oder?
Nein. Aber das hat System und es ist typisch für einen großen Teil auch der politischen Versuche, Ungleichheiten zu reduzieren. In der Regel sind sie dann halt doch wieder von einem einseitigen Blick gelenkt. Die Empathie oder auch nur der analytische Sinn dafür, dass es Positionen gibt, wo Menschen systematisch, strukturell und dauerhaft deutlich schlechtere Chancen haben, fehlt. Leider.
Einer Studie aus den USA zufolge sind wir in Deutschland als Gesellschaft zuletzt wieder zusammengerückt – allerdings war diese „interne Solidarität“ in den zehn Jahre davor nur zurückgegangen. Wir haben also viel aufzuholen?
Solidarität ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil die, die zusammenrücken, damit auch dafür sorgen, dass Andere, die nicht mit zusammenrücken dürfen oder können, außen vor bleiben. Zusammenrücken ist also keineswegs immer nur etwas Harmloses oder nur Positives. Die Frage ist: Woran misst man Solidarität? Misst man sie daran, dass Leute in Umfragen sagen: „Ja, ich hab’ jetzt in der Pandemie mehr auf meine Nachbarn geachtet!“ Oder: „Ja, ich habe tatsächlich Angehörige und/ oder wildfremde Menschen unterstützt!“? Solidarität ist eine Praxis, etwas, dass man leben muss, was man nicht nur irgendwie mal rasch in Fragebögen ankreuzt. Es ist Arbeit! Bei Solidarität geht’s darum, dass man gemeinsam mit Anderen nicht einfach etwas für Andere macht, sondern miteinander Problemlagen, Notlagen, Missstände zu beheben oder zumindest zu bearbeiten versucht. In dem Sinn ist Solidarität in unserer Gesellschaft definitiv unterausgeprägt.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Wir leben jetzt seit mehreren Jahrzehnten in einer Gesellschaft, wo man, wenn man in ihr aufgewachsen ist, von Anfang an darauf orientiert wurde, dass es Wettbewerb gibt, dass Konkurrenz herrscht, dass man sehen muss, wo man bleibt, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringen soll – und dann erst, in zweiter oder in dritter Instanz, vielleicht auch mal auf Andere schaut. Es ist mittlerweile tief in den Köpfen der Leute drin, dass sich Solidarität nicht unbedingt auszahlt. Sondern dass es sich auszahlt, erst mal auf sich selbst zu achten.
Apropos Schäfchen im Trockenen: Die Schere zwischen arm und reich geht in Deutschland schon seit Jahren immer weiter auf. Das tut uns als Gesellschaft auch nicht gut, oder?
Deutschland ist nicht nur das vermögensungleichste Land in Europa, wir haben auch den größten Niedriglohnsektor in der EU und die Tendenz ist nicht, dass das abnehmen würde. Im Gegenteil. Im Zuge der Finanzkrise und jetzt auch der Coronakrise ist es eher so, dass diejenigen, die über Finanzkapital verfügen oder über die Möglichkeit, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, die Chance haben werden, ihre Position zu verbessern. Wer da schlau war, hat beispielsweise schon früh in Medizintechnik investiert und wird daraus seine Renditen beziehen. Die zunehmende Ungleichheit von Vermögen und Lohneinkommen wird so immer mehr zum Funktionsproblem dieser Gesellschaft – das sagen auch führende Ökonomen. Ich persönlich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube: Ungleichheit zerfrisst eine Gesellschaft. Die Bereitschaft, solidarisch zu sein, miteinander bestimmte Ziele zu erreichen, wird durch Ungleichheiten unterlaufen. Und je sichtbarer die werden, umso gefährdeter ist das Miteinander im Land.
Das gesellschaftliche Klima in Deutschland ist schon länger angespannt, teilweise vergiftet, Stichwort: Hatespeech etc. Woran liegt es, dass uns die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Dialog immer mehr abhanden kommen?
Das Problem hat viele Facetten. Die sozialen Medien mit ihrer internen Logik der Kommunikation sind natürlich sperrangelweit offen für solche nicht konstruktiven Formen der Auseinandersetzung. Man ist da im geschützten Raum und kann aus einer anonymen oder halbanonymen Position heraus ganz schnell mal menschenverachtende oder verunglimpfende Aussagen posten. Abgesehen davon gibt es kaum mehr Räume, wo man konstruktive Dialoge führen oder auch Konflikte austragen könnte, in denen es um die Sache geht, wo man miteinander ringt und am Ende vielleicht auch feststellt, wir kommen da nicht überein, wir haben unterschiedliche Positionen, und ich kämpfe aber für meine und du für deine. Das nenn’ ich Demokratie! Nur: Wo finden solche verbindlichen Debatten noch statt? Die Parlamente waren zuletzt wegen Corona weitestgehend stillgelegt. Schulen wären ganz wichtige Räume, wo so was eingeübt wird. Auch Universitäten. Aber sowohl Schulen wie Universitäten sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher darauf geeicht worden, schnell und zügig Kompetenzen zu vermitteln, damit die Leute auf Arbeitsmärkten Erfolg haben können. „Schulen der Demokratie“ im Sinne von wirklich einer ernsthaften Auseinandersetzung über politische Fragen, über die Gestaltung von gesellschaftlichen Verhältnissen, haben wir im engeren und weiteren Sinne kaum mehr – und das trägt natürlich dazu bei, dass man nicht mehr eingeübt ist in den gepflegten Diskurs.
Wie gefährlich ist das für eine Gesellschaft?
Ich glaube, man muss kein Kommunikationstheoretiker sein, um sich das zu vorzustellen. Der Austausch, auch der alltagspraktische, über Gesellschaftliches ist zentral für das Zusammenleben oder auch den „Zusammenhalt“ in einer Gesellschaft, wobei „Zusammenhalt“ in meinen Ohren immer so starr und statisch klingt, nach Zusammenkleben, was unserer vielfältigen, bunten und dynamischen Gesellschaft so gar nicht entspricht. Fakt ist: Wenn man nicht mehr miteinander im Gespräch ist darüber, wie wir leben wollen, wie wir leben müssen, was eigentlich möglich ist und was ausgeschlossen; wenn es keine Kommunikation mehr gibt und auch keine institutionellen Möglichkeiten, diese Kommunikation immer wieder neu zu führen, ist das für eine Gesellschaft fatal.
Corona hat diese Gesellschaft weiter polarisiert – und jetzt wird auch noch gewählt. Welche tektonischen Verschiebungen in der politischen Landschaft erwarten Sie bei der Bundestagswahl am 26. September?
Ich glaube, die Akteure im politischen Raum, vor allem die in den machtvollen Positionen, sind schon lange auf Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün gepolt. Von daher wird es in der politischen Farbenlehre wohl schon Veränderungen geben. Aber dass es zu tektonischen Verschiebungen im politischen Gesamtzusammenhang, auch inhaltlicher Art, kommt, wage ich zu bezweifeln. Wenn es eine von den Grünen geführte Bundesregierung gäbe, würden sicher viele Dinge anders gemacht als bisher. Dann würde die Klimapolitik sehr viel prominenter werden, dann würde auch eine antirassistische Politik deutlich wichtiger werden, womöglich würden bestimmte Formen sozialer Ungleichheit stärker thematisiert als bisher. Aber an einen wirklichen Umbruch glaube ich nicht. Dafür sind die Institutionen in Berlin und anderswo zu träge. Auch die Grünen stehen ja nicht gerade für eine radikale Transformation von Gesellschaft, sondern eher für eine, die der Gesellschaft möglichst wenig weh tut, wo man die unabweisbaren Probleme, die sich in der Zukunft auftürmen, aber wenigstens nicht beschweigt oder bestreitet, sondern sich ihnen stellt.
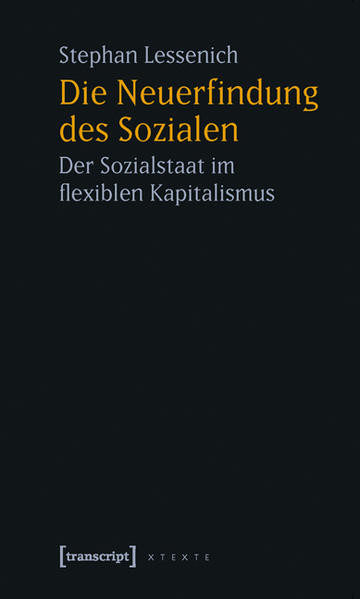


Autor Lessenich: „Tatsachen, die man gern verdrängt“ / Foto: Magdalena Jooss
In der Pandemie richtete sich die Politik anfangs stark nach den Empfehlungen der Virologen und Epidemiologen. Und im Ethikrat in Bayern (!) sitzt mit Ihrem Kollegen Armin Nassehi sogar ein Soziologe. Was halten Sie von dieser Art „kuratiertem Regieren“? Ist das ein Politikmodell mit Zukunft?
Also, ich glaube, wenn Soziolog*innen und andere kompetente Wissenschaftler*innen Regierungsakteure beraten, muss das nicht schlecht sein. Es ist wahrscheinlich sogar besser als wenn sie nicht gefragt werden. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung von politischen Problemen darin liegt, dass sich Regierende wissenschaftliche Räte, Beiräte, Ausschüsse oder Expertengremien schaffen, die ja in der Regel doch auch nicht ganz nah dran sind am sozialen Leben. Da würde ich eher für Bürger*innenräte plädieren, meinetwegen auch als weiteres Gremium im Dunstkreis der Staatskanzlei. Also, man trifft sich nicht nur regelmäßig und bekommt nicht nur Expertisen von Ethik- und anderen Räten, die mit Wissenschaftler*innen und Expert*innen besetzt sind. Sondern man lädt per Zufallslos eine repräsentative Auswahl von Bürger*innen ein, an einem Bürgerausschuss/ Bürgerrat teilzunehmen, vielleicht zwei Jahre lang, um aus einer ganz anderen Perspektive noch mal einen Input in die Politik zu geben. Ich glaube, das würde eher einen Unterschied machen.
Der Philosoph Markus Gabriel hat letzten Sommer ein aufmunterndes Buch über den „Moralischen Fortschritt in dunklen Zeiten“ geschrieben. In etwa um dieselbe Zeit machten sich Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Neonazis daran, den Berliner Reichstag zu stürmen. Was meinen Sie: Ist das Glas in Deutschland halb voll oder halb leer?
Als „linker“ Soziologe mit dem Anspruch, Gesellschaft nicht nur zu verstehen, sondern auch verändern zu wollen, muss ich mir einen gewissen Optimismus bewahren. Es liegt viel im Argen, ja. Es ist so, dass ganz viele Missstände materiell, aber auch ideell herrschen, dass Demokratie gefährdet ist, dass Solidarität in dieser Gesellschaft unterausgeprägt ist, dass es viel Gleichgültigkeit gibt gegenüber dem Leiden Anderer. Aber es gibt eben auch viele Menschen, Organisationen, ganz alltägliche Praktiken auch, die dem etwas entgegensetzen, und das sollte man ja nicht verschweigen. Denn es ist erstens politisch wenig geholfen damit. Und zweitens ist es auch empirisch, von der Beschreibung der Gesellschaft her, nicht zutreffend, wenn man sagt: Alles ist schlecht und alles geht den Bach hinunter. Deshalb ist das Glas für mich halb voll.
Stephan Lessenich, Jahrgang 1965, hat Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert. Er lehrte Vergleichende Gesellschafts- Kulturanalyse in Jena, bevor er 2014 von Ulrich Beck den Lehrstuhl für Soziale Entwicklungen und Strukturen am Institut für Soziologie der Münchner LMU übernahm. Der gebürtige Stuttgarter ist das Paradebeispiel eines Forschers, der nicht nur "zeitdiagnostische Deutungsarbeit" leistet. Er bringt sich auch selbst in gesellschaftliche Prozesse ein - etwa als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac oder 2017 als Mitbegründer der Partei „mut“. Seit 1. Juli 2021 ist Lessenich Professor an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiter des international renommierten Instituts für Sozialforschung. Er will das IfS als "Denkfabrik einer postpandemischen Gesellschaft" neu etablieren.




